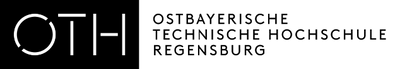Dopamin

Basic
Hier erfährst du die Grundlagen – einfach und verständlich erklärt.
Alternative Namen von Dopamin
Dopamin wird umgangssprachlich als Glückshormon bezeichnet, obwohl es streng genommen kein Hormon im klassischen Sinne ist, sondern primär ein Neurotransmitter.
Die Molekülformel lautet C₈H₁₁NO₂. Ausgehend von der chemischen Struktur verwenden medizinische Fachwerke auch Bezeichnungen wie 4-(2-Aminoethyl)brenzcatechin oder 3-Hydroxytyramin.1
Die ebenfalls gebräuchliche Bezeichnung Inotropin verweist auf die positiv inotrope, d.h. die Kontraktionskraft des Herzens verstärkende Wirkung des Stoffes.2
Was ist Dopamin?
Dopamin ist ein lebenswichtiges Hormon, das auch als Neurotransmitter wirkt. Es dient zur Signalübermittlung im zentralen Nervensystem, sowohl auf endokrinen als auch auf neuronalen Pfaden.
Chemisch zählt es zu den biogenen Aminen und wird – gemeinsam mit Adrenalin und Noradrenalin – der Gruppe der Catecholamine zugeordnet.3 Auf diese Klassifizierung verweist auch der Name von Dopamin, der sich aus DOPA und Amin zusammensetzt. DOPA steht dabei für Dihydroxyphenylalanin, eine Zwischenstufe in der Biosynthese.4
Bekannt ist Dopamin vor allem als “Glückshormon”: Es sorgt jedoch nicht für den umgangssprachlichen “Dopaminkick” im Belohnungssystem, sondern ist ein wichtiger Regulator von Motivation und Verhaltenssteuerung.
Dopamin hat zudem eine wichtige Funktion für die Motorik und beeinflusst die Organtätigkeit.
Welche Funktion übernimmt Dopamin im Körper?
Als Neurotransmitter ist Dopamin an vielen lebensnotwendigen Steuerungs- und Regelungsvorgängen beteiligt. Die Wirkung wird über verschiedene Rezeptoren-Typen im zentralen und peripheren Nervensystem vermittelt.
Funktion im zentralen Nervensystem:
- Emotionen & Kognition: Dopamin spielt eine Schlüsselrolle für die Funktion des limbischen Systems und seine Verknüpfung mit der Hirnrinde (Cortex).
- Motorik: Im nigrostriatalen System des Gehirns ist Dopamin maßgeblich an der Koordination von Bewegungsabläufen beteiligt.
- Brechzentrum: Die Aktivierung der im Hirnstamm gelegenen Area postrema kann Erbrechen auslösen.
- Hypophyse: Die Freisetzung von Dopamin aus dem Hypothalamus in Richtung Hypophyse (Hirnanhangdrüse) regelt die Freisetzung von Hormonen wie Prolactin.5
Funktion im peripheren Nervensystem:
- Niere und Darm: Hier wirkt Dopamin gefäßerweiternd und durchblutungsfördernd, die Darmbewegung wird angeregt.6
- Speiseröhre: Dopamin mindert den Druck im unteren Schließmuskel der Speiseröhre und wirkt damit refluxfördernd.7
Zudem ist Dopamin ein Vorläufer für die Synthese von zwei weiteren Neurotransmittern: Adrenalin und Noradrenalin.8
Als Medikament wird Dopamin in der Notfallmedizin eingesetzt, insbesondere bei Schockzuständen.9
Wie wird Dopamin im Körper reguliert?
Die Dopaminsynthese findet hauptsächlich im Nebennierenmark und in den Neuronen des zentralen Nervensystems statt. Allerdings kann Dopamin die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden, d.h. das in der Nebenniere produzierte Hormon kann nicht über das Blut ins Hirn gelangen und dort als Neurotransmitter wirken. Somit bestehen zwei unabhängige Regelkreise.10
Im zentralen Nervensystem unterscheidet man zwei Modi der Dopaminfreisetzung: tonisch und phasisch. Die Neuronen in den cortico-striatalen Bahnen des Gehirns steuern die tonische Freisetzung, die den Dopaminspiegel im extrazellulären Raum zwischen den Synapsen bestimmt. Bei Erregung der nigrostriatalen Bahn, beispielsweise durch einen externen, insbesondere neuartigen Reiz oder eine Belohnungsreaktion beim Lernen, erfolgt dann die phasische Freisetzung von Dopamin.
Wenn die Rezeptoren einen hohen tonischen Dopaminspiegel registrieren, wird die phasische Ausschüttung gehemmt – bei einem niedrigen tonischen Spiegel fällt die phasische Reaktion hingegen stärker aus. Zudem kann überschüssiges Dopamin über ein Transportprotein aus dem synaptischen Spalt entfernt und wieder in die Neuronen aufgenommen werden.11
Wie wirkt sich Dopamin auf meine Stimmung und mein Verhalten aus?
Dopamin vermittelt das Erleben lustvoller Erfahrungen – beim Essen, aber auch beim Konsum abhängig machender Substanzen wie Nikotin, Kokain oder Heroin12 und last but not least im Kontext sexuellen Begehrens.13 Der Fokus liegt jedoch weniger auf dem Genuss an sich, als um den Appetit darauf bzw. das Streben danach.14
Damit ist das dopamingesteuerte Belohnungssystem ein Schlüsselfaktor für motiviertes Verhalten: Die Dopaminausschüttung erfolgt zunächst bei Eintritt der tatsächlichen “Belohnung”, später bereits in Erwartung derselben. Unser Gehirn lernt also, welches Verhalten in bestimmten Situationen eine Belohnung einbringt, bewertet die Güte der Belohnung und regelt, wie intensiv wir danach streben. Dieser Lern- und Motivationsprozess greift auch bei negativen Belohnungen, d.h. Bestrafungen, die wir durch entsprechendes Verhalten zu vermeiden suchen.15
Der Dopaminspiegel beeinflusst auch die kognitive Kontrolle, d.h. wie konsequent wir ein gesetztes Ziel im Arbeitsgedächtnis behalten, wie gut wir zwischen Aufgaben wechseln können bzw. wie schnell wir uns ablenken lassen. Die Einschränkung der kognitiven Kontrolle steht im Zusammenhang mit “unvernünftigen” Verhaltensweisen wie zum Beispiel ungesunden Gewohnheiten bis hin zu Suchtverhalten und psychischen Störungen.16
Was passiert, wenn ich zu viel Dopamin habe?
Ein Zuviel an Dopamin intensiviert die Wahrnehmung von Sinneseindrücken, Körperempfindungen und Gedanken: Die Reizweiterleitung wird verstärkt, das Gehirn wird derart überschwemmt mit Eindrücken, dass es diese nicht mehr ordnen oder kontrollieren kann. Diese gestörte Informationsverarbeitung kann zu verfälschten Wahrnehmungen führen. Ein solcher Dopaminüberschuss kann nach Einnahme bestimmter Drogen auftreten, ist aber auch in Zusammenhang mit psychischen Störungen wie Schizophrenie zu beobachten.17
Was passiert, wenn ich einen Dopaminmangel habe?
Zu wenig Dopamin kann zur Entstehung depressiver Verstimmungen beitragen. Störungen des Belohnungssystems werden insbesondere mit Symptomen wie Anhedonie (Verminderung positiver Gefühlserlebnisse) und Motivationsverlust in Verbindung gebracht.18 Auch bei Symptomen wie mangelnder Energie und anhaltender Erschöpfung trotz ausreichend Schlaf werden Störungen des Dopaminsystem als mögliche Ursache diskutiert.19
Störungen des Dopaminsystems werden auch als Ursachen von ADHS diskutiert. Zu den Symptomen zählen unter anderem verminderte Aufmerksamkeit bzw. erhöhte Ablenkbarkeit.20
Dopaminmangel kann auch zur Entwicklung von extrapyramidalen Bewegungsstörungen führen. Betroffen ist dabei nicht die willentlich gesteuerte Motorik (beispielsweise das Heben der Hand), sondern die automatisierte bzw. unwillkürliche Motorik. Diese Bewegungsstörungen können bereits im Kindesalter auftreten21 als auch im fortgeschrittenen Alter wie beispielsweise in Form der Parkinson-Krankheit.22
Advanced
Dieser Abschnitt vertieft dein Wissen und gibt dir detailliertere Einblicke.
Wann ist mein Dopaminspiegel am höchsten und wann am niedrigsten?
Dopamin steht in enger Wechselbeziehung mit den zirkadianen Rhythmen unseres Gehirns. Am höchsten ist der Wert morgens nach dem Aufstehen. Im Tagesverlauf fällt er ab, steigt kurz vor dem Schlafengehen noch einmal leicht an und erreicht dann im Schlaf seinen Tiefstwert.23
Zudem verändert sich der Dopaminspiegel auch im Jahresrhythmus, wobei die Synthese in der dunklen Jahreszeit, also im Herbst und Winter, erhöht ist.24
Wie kann ich meinen Hormonspiegel beeinflussen?
Es gibt viele Möglichkeiten, das Dopamin-System auf positive Weise zu stimulieren:
- Sport25
- Sonnenlicht und damit das Ankurbeln der körpereigenen Vitamin-D-Produktion26
- Massage27
- Meditation und Achtsamkeitsübungen28
- Musik29
- generell Tätigkeiten, die das Belohnungssystem stimulieren und zu Flow-Zuständen führen können – von kreativen Tätigkeiten wie Zeichnen und Handarbeiten bis hin zu Kochen, Gärtnern und DIY30
- neuartige Erlebnisse31
Weitere wichtige Einflussfaktoren sind die Ernährung (siehe: Welche Lebensmittel können meinen Dopaminspiegel beeinflussen?) und Schlafgewohnheiten (siehe: Wie beeinflusst Schlaf meinen Dopaminspiegel?).
Welche Lebensmittel können meinen Dopaminspiegel beeinflussen?
Mit Lebensmitteln, die reich an Tyrosin sind, liefern wir unserem Körper den wichtigsten Ausgangsstoff für die Dopaminsynthese (siehe: Welche Stoffe sind an der Bildung von Dopamin beteiligt?). Dazu zählen vor allem proteinreiche Lebensmittel wie:
- Fleisch (Rind, Lamm, Schwein, Huhn),
- Käse und Milchprodukte,
- Eier sowie
- Sojabohnen, Nüsse, Bohnen und Vollkornprodukte.32
Bei geringer Aufnahme von Tyrosin über die Nahrung kann unser Körper diese nicht-essentielle Aminosäure auch selbst bilden und zwar aus Phenylalanin, das ebenfalls in Fleisch, Milchprodukten und Ei, aber auch in Weizen, Mais und Spinat enthalten ist.33
Stark zuckerhaltige Getränke34 wie auch zucker- und fettreiche Lebensmittel wie beispielsweise Eiscreme35 lösen zunächst einen starken Dopaminschub aus, führen auf Dauer aber zur Gewöhnung und damit geringerem Belohnungseffekt.
Wie verändert sich Dopamin mit dem Alter?
Die Fachliteratur geht davon aus, dass das Dopamin-System um etwa 5-10 % pro Jahrzehnt abnimmt. Im Hinblick auf die Synthese des Neurotransmitters ist die Studienlage unklar, doch bei Dopamin-Rezeptoren und -Transportern zeigen sich deutliche Alterungseffekte.36
Wie beeinflusst Schlaf meinen Dopaminspiegel?
Dopamin spielt eine wichtige Rolle für die Schlaf-Wach-Regulation und auch umgekehrt beeinflusst der Schlaf den Dopaminspiegel. So zeigen Studien, dass dieser bereits nach einer durchwachten Nacht in zwei Gehirnarealen (Striatum und Thalamus) deutlich erhöht ist. Offenbar versucht der Körper auf diese Weise die Müdigkeit zu kompensieren, was jedoch nur unvollständig gelingt: Die kognitiven Fähigkeiten der Versuchspersonen waren messbar reduziert.37
Welche falschen Mythen gibt es über Dopamin?
Ob im Internet oder in der Buchhandlung: Dopamin ist ein beliebtes Thema, das in vielen Ratgebern behandelt wird. Allerdings kursieren dabei auch Halbwahrheiten und Mythen, die wir hier richtig stellen möchten:
Expert
Hier geht es um fortgeschrittene Konzepte für ein tiefgehendes Verständnis.
Welche Stoffe sind an der Bildung von Dopamin beteiligt?
Der Ausgangsstoff für die Dopaminsynthese ist die Aminosäure Tyrosin: Diese wird unter Mitwirkung des Enzyms Tyrosinhydroxylase zunächst in Dihydroxyphenylalanin (DOPA) umgewandelt, das dann durch DOPA-Decarboxylase zu Dopamin wird.41
Welche Stoffe entstehen aus Dopamin?
Dopamin ist Teil der Synthesekette von zwei weiteren Neurotransmittern: Noradrenalin und Adrenalin. Die Umwandlung zu Noradrenalin wird durch das Enzym Dopamin-β-Hydroxylase katalysiert, der zweite Umwandlungsschritt von Noradrenalin zu Adrenalin dann durch das Enzym Phenylethanolamin-N-Methyltransferase (PNMT).42
Weitere Stoffe entstehen beim Abbau von Dopamin: Zum einen wird es durch Catechol-O-Methyltransferase (COMT) zu Methoxytyramin verstoffwechselt. Zum anderen wird es durch Monoaminoxidase (MAO) in ein Aldehyd umgewandelt, das dann über Dihydroxyphenylessigsäure zu Vanillinmandelsäure metabolisiert wird. Daneben kann Dopamin auch in Schwefelsäure-Konjugate umgewandelt werden.43
Wissenschaftliche Quellen
- Artur Burger, Helmut Wachter: Hunnius pharmazeutisches Wörterbuch. de Gruyter 1993 ↩
- Joseph Varon, Pilar Acosta: Handbook of Critical and Intensive Care Medicine. Springer 2010, S. 401. ↩
- Michael Freissmuth, Stefan Offermanns, Stefan Böhm: Pharmakologie und Toxikologie. Springer 2016, S. 148. ↩
- Tobias Amshoff et al.: physiolexikon. Physiotherapie von A bis Z. Thieme 2010. ↩
- Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Lutz Hein: Pharmakologie und Toxikologie. Thieme 2010, S. 107. ↩
- Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Lutz Hein: Pharmakologie und Toxikologie. Thieme 2010, S. 107. ↩
- Stefan Silbernagl, Florian Lang: Taschenatlas Pathophysiologie. Thieme 2009, S. 148-149. ↩
- Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Lutz Hein: Pharmakologie und Toxikologie. Thieme 2010, S. 94. ↩
- Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Lutz Hein: Pharmakologie und Toxikologie. Thieme 2010, S. 108. ↩
- Hanns-Georg Klein, Ekkehard Haen: Pharmakogenetik und Therapeutisches Drug Monitoring. De Gruyter 2018, Kap. 3.12.1. ↩
- Iris Reuter: ELSEVIER ESSENTIALS Parkinson. Urban & Fischer 2018, S. 14-15 SOWIE Steinhausen/Döpfner/Holtmann/Philipsen/Rothenberger (Hg.): Handbuch ADHS. Kohlhammer 2020, S. 89. ↩
- Michael Freissmuth, Stefan Offermanns, Stefan Böhm: Pharmakologie und Toxikologie. Springer 2016, S. 148. ↩
- James G. Pfaus: Pathways of Sexual Desire. In: The Journal of Sexual Medicine 2009, Vol. 6 (6), S. 1506–1533, https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2009.01309.x. ↩
- K. C. Berridge: Food reward. Brain substrates of wanting and liking. In: Neuroscience and Biobehavioral Reviews 1996, Vol. 20 (1), S.1-25. https://doi.org/10.1016/0149-7634(95)00033-b ↩
- Jutta Heckhausen, Heinz Heckhausen: Motivation und Handeln. Springer 2010, S. 265, 267, 272. ↩
- Martina Rieger, Jochen Müsseler (Hg.): Allgemeine Psychologie. Springer 2024, S. 351-352. ↩
- Rudolf Schneider: Psychiatrie leicht verstehen. Elsevier 2017, S. 117. ↩
- Heinz Böker, Erich Seifritz (Hg.): Psychotherapie und Neurowissenschaften. Hogrefe 2012, S. 244- ↩
- Ekaterina Dobryakova et al.: The dopamine imbalance hypothesis of fatigue in multiple sclerosis and other neurological disorders. In: Frontiers in neurology 2015, 6: 52, https://doi.org/10.3389/fneur.2015.00052. ↩
- Steinhausen/Döpfner/Holtmann/Philipsen/Rothenberger (Hg.): Handbuch ADHS. Kohlhammer 2020, S. 89, 92-93. ↩
- Christian Speer, Manfred Gahr: Pädiatrie. Springer 2009, S.258. ↩
- Iris Reuter: ELSEVIER ESSENTIALS Parkinson. Urban & Fischer 2018, S. 14. ↩
- Jaime M. Monti et al. (Hg.): Neurochemistry of Sleep and Wakefulness. Cambridge University Press 2011, S. 187-189. ↩
- Daniel P. Eisenberg et al.: Seasonal effects on human striatal presynaptic dopamine synthesis. In: Journal of Neuroscience 2010, Vol. 30 (44), S. 14691-14694, https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1953-10.2010. ↩
- Adilson Marques et al.: Bidirectional association between physical activity and dopamine across adulthood—A systematic review. In: Brain Sciences 2021, Vol. 11(7), https://doi.org/10.3390/brainsci11070829. ↩
- Hua-Lin Wang et al.: Vitamin D Plays a Crucial Role in Regulating Dopamine Nervous System in Brain. In: Progress in Biochemistry and Biophysics 2024, Vol. 51 (7), S. 1530-1539, http://wprim.whocc.org.cn/admin/article/articleDetail?WPRIMID=1039030&articleId=1054250. ↩
- Tiffany Field et al.: Cortisol decreases and serotonin and dopamine increase following massage therapy. In: International Journal of Neuroscience 2005, Vol. 115(10), S. 1397-1413, https://doi.org/10.1080/00207450590956459. ↩
- Harald Walach, Stefan Schmidt (Hg.): Meditation. Neuroscientific Approaches and Philosophical Implications. Springer 2014, Kapitel “The Neurobiology of Meditation and Mindfulness”, S. 153-173. ↩
- Valorie N. Salimpoor et al.: Anatomically distinct dopamine release during anticipation and experience of peak emotion to music. In: Nature Neuroscience 2011, Vol. 14, S. 257–262, https://doi.org/10.1038/nn.2726. ↩
- Sharon A. Gutman, Victoria Schindler: The neurological basis of occupation. In: Occupational Therapy International 2007, Vol. 14(2), S. 71-85. https://www.researchgate.net/profile/Sharon-Gutman/publication/6215448_The_neurological_basis_of_occupation/links/5ad34da2458515c60f529ff4/The-neurological-basis-of-occupation.pdf ↩
- J. C. Horvitz: Mesolimbocortical and nigrostriatal dopamine responses to salient non-reward events. In: Neuroscience 2000, Vol. 96(4), S. 651-6. https://doi.org/10.1016/s0306-4522(00)00019-1 ↩
- Simone Kühn: Food for thought: association between dietary tyrosine and cognitive performance in younger and older adults. In: Psychological Research 2019, Vol. 83(6), S. 1097-1106, https://doi.org/10.1007/s00426-017-0957-4. ↩
- Claus Leitzmann: Ernährung in Prävention und Therapie. Hippokrates-Verlag 2003, S. 367-369. ↩
- Afroditi Papantoni, Kyle Burger: High Sugar Intake from Beverages Is Associated with Decreased Dopaminergic Brain Response to Sugar. In: Obesity 2021, Vol. 29, S. 18-19, https://doi.org/10.1093/cdn/nzab049_027. ↩
- Kyle Burger, Eric Stice: Frequent ice cream consumption is associated with reduced striatal response to receipt of an ice cream–based milkshake. In: The American journal of clinical nutrition 2012, Vol. 95(4), S. 810-817, https://doi.org/10.3945/ajcn.111.027003. ↩
- Teresa M. Karrer et al.: Reduced dopamine receptors and transporters but not synthesis capacity in normal aging adults: a meta-analysis. In: Neurobiology of Aging 2017, Vol. 57, S. 36-46, https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2017.05.006. ↩
- Nora Volkow et al.: Sleep deprivation decreases binding of [11C] raclopride to dopamine D2/D3 receptors in the human brain. In: Journal of Neuroscience 2008, Vol. 28 (34), S. 8454-8461, https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1443-08.2008. ↩
- Peter Grinspoon: Dopamine fasting: Misunderstanding science spawns a maladaptive fad. Harvard Health Publishing, URL: https://www.health.harvard.edu/blog/dopamine-fasting-misunderstanding-science-spawns-a-maladaptive-fad-2020022618917. ↩
- Christoph Niederau, Bernhard O. Böhm: Klinikleitfaden Labordiagnostik. Elsevier / Urban & Fischer 2024, S. 364-366. ↩
- Michal R. Post, David Sulzer: The chemical tools for imaging dopamine release. In: Cell Chemical Biology 2021, Vol. 28(6), S. 748-764, https://doi.org/10.1016/j.chembiol.2021.04.005. ↩
- Michael Freissmuth, Stefan Offermanns, Stefan Böhm: Pharmakologie und Toxikologie. Springer 2016, S. 148. ↩
- Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Lutz Hein: Pharmakologie und Toxikologie. Thieme 2010, S. 94-96. ↩
- Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Lutz Hein: Pharmakologie und Toxikologie. Thieme 2010, S. 108 SOWIE Michael Freissmuth, Stefan Offermanns, Stefan Böhm: Pharmakologie und Toxikologie. Springer 2016, S. 149. ↩

JETZT 15% SPAREN & GLÜCKLICH SEIN
Melde dich jetzt zu unserem kostenlosen Newsletter an und erhalte 15% Rabatt auf deine erste Bestellung!
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen. Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit möglich.